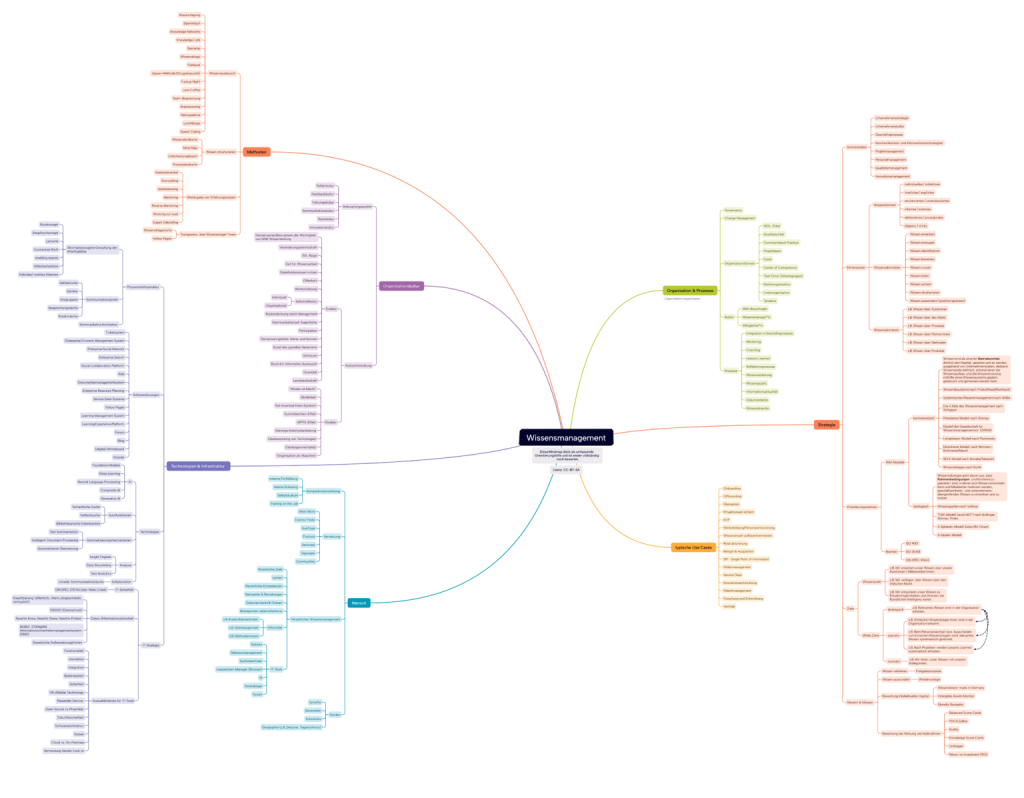Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an die kleine Serie hier in meinem Blog vor fast einem Jahr, in der wir teilweise auch gemeinsam über Künstliche Intelligenz (KI) philosophiert haben (ist sie intelligent? ist sie kreativ? verfügt sie über Wissen?…).
Nun habe ich dazu heute Interessantes gelesen, und zwar von David Autor (Applying AI to Rebuild Middleclass Jobs. NBER Working Paper 32140). Autor geht explizit auf die Polanyischen Kategorien ‚explizites‘ und ‚implizites‘ Wissen ein, wenn er darlegt wie sich Digitalisierung und KI auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt haben und aktuell auswirken. Er argumentiert, das explizite Wissen, also das laut Polanyi gut verbalisierbare Wissen, sei bereits in den vergangenen Jahrzehnten der Digitalisierung in Computercodes und Algorithmen übertragen worden, wodurch Berufe der Mittelschicht, in denen es vorrangig um dieses Wissen geht, unter Druck gerieten. Ebenso wie minder qualifizierte Berufe, weil nun mehr Menschen in diese Berufe drängten. Profitiert hätten hoch qualifizierte Wissensarbeitenden: Computer hätten es diesen Expert:innen ermöglicht sich auf die Interpretation und (komplexe, Anm. der Autorin) Verwendung von Informationen zu konzentrieren, wofür es auf das implizite Wissen ankomme, das Computer bisher nicht nachbilden konnten.
Nun könne, so Autor, aber die KI Regeln eigenständig entwickeln und damit implizites Wissen, das schwer weiterzugeben ist, selbst erlernen: „Künstliche Intelligenz kann auf der Grundlage von Training und Erfahrung improvisieren. So kann sie Expertenurteile fällen – eine Fähigkeit, die bisher nur Eliteexperten vorbehalten war. Obwohl sie erst in den Kinderschuhen steckt (…)“.
Autors Theorie eines Statusverlusts von Expert:innen wird durch Studien aus der Praxis bestätigt. So haben beispielsweise Kolleg:innen von Autor am MIT Akademiker:innen unterschiedliche Schreibaufgaben gestellt, die einmal mit, einmal ohne Hilfe einer KI bearbeitet werden sollten. Dabei hat sich gezeigt, dass sich zwar alle mittels der KI verbesserten, sowohl hinsichtlich der Effizienz als auch des Ergebnisses, die schwächeren Schreiber aber deutlich mehr als die bereits guten. D.h. der Abstand zwischen Mittelbau und Elite wird mit KI geringer.