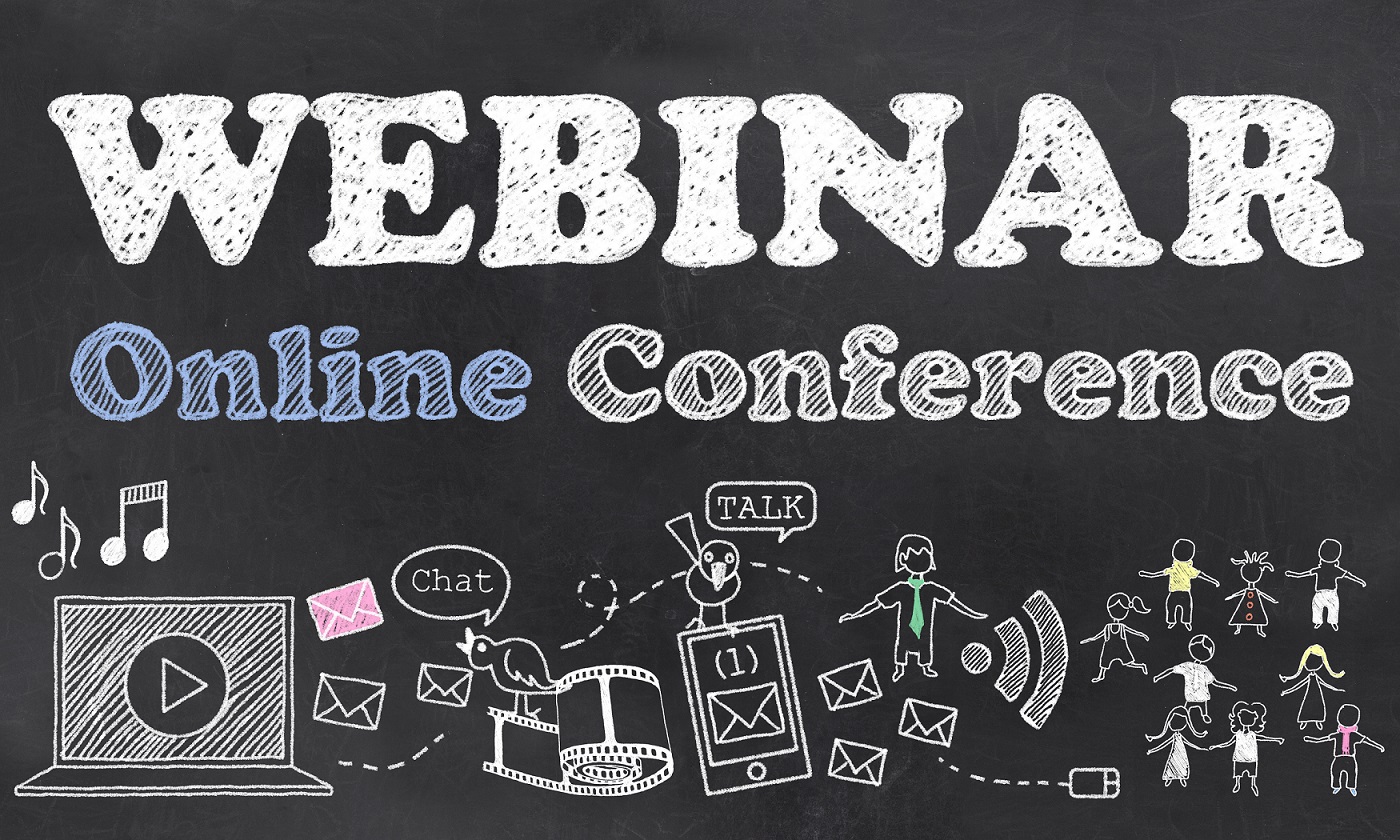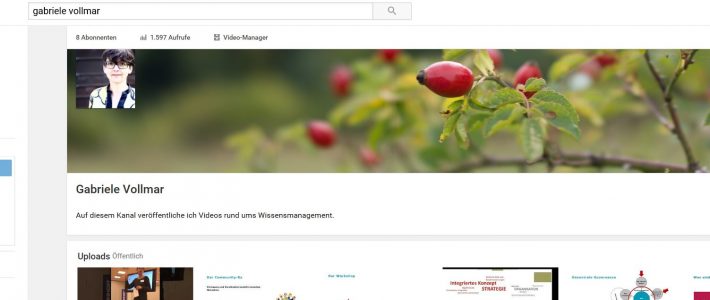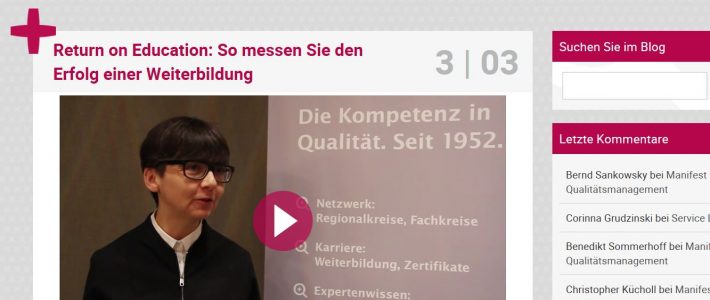Letzte Woche haben wir, ‚wir‘ heißt das Stuttgarter Regionaltreffen der GfWM, das Unternehmen DEXINA besucht, um uns dort eine so genannte neue Arbeitswelt einmal live anzuschauen.
Alles begann damit, dass sich Heiner Scholz, Gründer und Geschäftsführer der DEXINA GmbH vor ein paar Jahren fragte, wo eigentlich das Leben bleibt, wenn wir arbeiten. Work-Life-Balance war für ihn nicht genug, vielmehr sollte es um LIVE AT WORK (Leben bei der Arbeit) gehen. Dieses Konzept bestimmt heute nicht nur den Alltag der DEXINA-Mitarbeiter, sondern wird als Beratungs-, Coaching- und Entwicklungskonzept auch weiter vertrieben.
Das Ziel von LIVE AT WORK ist es, „Arbeit zu einem Sinnstifter und Freudegenerator“ zu machen, so Sandra Dambacher-Schopf, die Pressereferentin des Unternehmens, die uns durch die DEXINA-Arbeitswelt – sprich modern eingerichtete Open Space-Büros in Böblingen, führte. Es gehe nicht darum, Leben und Arbeiten auszubalancieren, sondern vielmehr zu integrieren und darüber eine emotionale Verbundenheit mit der Arbeit zu schaffen. Und dabei spielen die räumlichen Gegebenheiten eine entscheidende Rolle. Weshalb Räume, nach der DEXINA-Philosophie, auch von innen heraus, aus der Identität des Unternehmens und seiner Menschen heraus entwickelt werden sollten. Am Beginn eines Raumkonzepts steht also die Identitätssuche des Unternehmens. Dann werden die Mitarbeiter nach ihren konkreten Bedürfnissen befragt.
Im Falle von DEXINA selbst beruht die Arbeitswelt auf dem Konzept der Open Spaces, inklusive Gemeinschaftsküche, Kinderbüro, abgeschiedenen Denkerzellen und – das beeindruckte uns mit am meisten – Wänden, die dank einer Spezialfarbe komplett als „Whiteboards“ bis unter die Decke fungieren. Hinzu kommen spezielle statisch aufgeladene Zettel, die sogenannten DEXits, die Dexina mittlerweile in einem eigenen Online-Shop vertreibt und die problemlos auch an den Fenstern haften. Und die Mitarbeiter machen überall ausgiebig Gebrauch von den Möglichkeiten ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen.
Laut Dambacher-Schopf ist die Umsetzung des Konzepts bei DEXINA stark auf Mitarbeiter der Generation Y ausgerichtet, also Mitarbeiter, die sich bedingungslos einsetzen, wenn die Arbeit sinnstiftend ist, die für sich selbst und ihr Tun die Verantwortung übernehmen und die Freiraum zur Selbstverwirklichung beanspruchen – schließlich liegt der Altersdurchschnitt bei DEXINA bei 33 Jahren. Aber Achtung: Die konsequente Umsetzung eines solchen Konzepts bedingt auch, dass es für so machen Mitarbeiter genauso nicht passend ist und in seiner Radikalität auch nicht einfach (er)tragbar. Sicherlich kein Patentrezept für jede Art von Organisation. Aber vielleicht doch ein Hinweis, wie die konkrete Gestaltung der Arbeitsumgebung im „war for talents“ oder auch im Kampf um den Wissensarbeiter zunehmend wichtig wird. Neben zahlreichen Auszeichnungen, darunter den New Work Award und den German Design Award, zeigt sich der Erfolg des Konzepts für DEXINA nach eigener Aussage unter anderem auch in 400% mehr Initiativbewerbungen, 29 Prozent weniger Krankheitstage und 4 Mal mehr Kindern.
Wer neugierig geworden ist: In diesem Video erläutert Heiner Scholz selbst seine Ideen zu Leben bei der Arbeit: